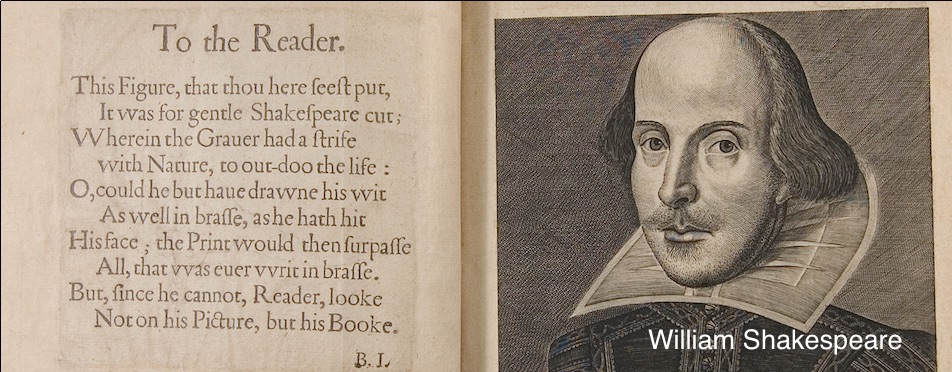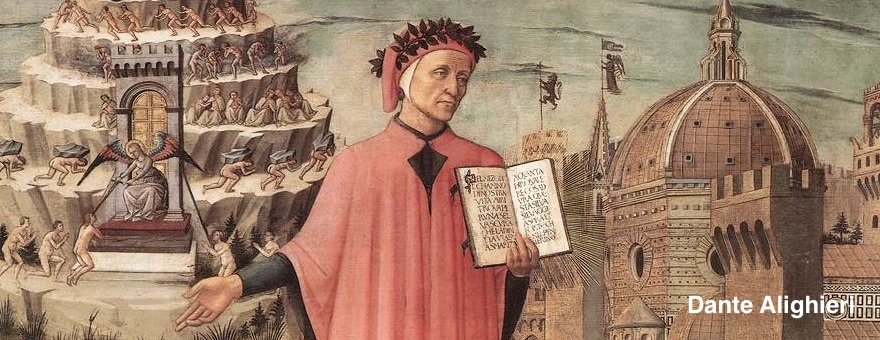21. und 28.1.2025
DR. PHIL. JAKOB KNAUS
MUSIK ZU FRIEDEN UND KRIEG

Die vom Referenten in seinen Vorträgen präsentierten Musikstücke verdeutlichen, dass Komponisten auf sehr unterschiedliche Weise mit den Themen Krieg und Frieden umgehen. Während einige Werke den Frieden feiern, setzen sich andere mit den Grausamkeiten des Krieges auseinander und mahnen zur Versöhnung.
Die "Feuerwerksmusik" komponierte Georg Friedrich Händel (1685–1759) im Jahre 1749 anlässlich des Friedens von Aachen, der den Österreichischen Erbfolgekrieg beendete. Der Satz "La Paix" (Der Frieden) zeichnet ein musikalisches Bild der Ruhe und Eintracht. Bei Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) ist "La Batalia" ein musikalisches Schlachtengemälde von 1673, das vermutlich für eine Karnevalsveranstaltung gedacht war. Es verdeutlicht durch Dissonanzen und ungewöhnliche musikalische Effekte die "liederliche Gesellschaft" und die chaotische "Schlacht". Die "Paukenmesse" komponierte Joseph Haydn (1732–1809) 1796 in den Wirren des ersten Koalitionskrieges gegen Napoleon, wobei das "Dona nobis pacem" zu einer eindringlichen Bitte um Frieden ertönt. Auch Ludwig von Beethoven (1770-1827) darf mit seiner Komposition "Wellingtons Sieg oder die Schlacht bey Vittoria" (1813) erwähnt werden, wo er die Schlacht musikalisch nachstellt. Die detaillierten Anweisungen zur Aufführung, einschliesslich der Platzierung von Musikern und der Verwendung von Kanonen und Ratschen, lassen die Schlacht lebendig werden. Ein weiterer Komponist zum Thema war Benjamin Britten (1913-1976). Sein "War Requiem" von 1962 ist eine Reaktion auf die Bombardierung von Coventry im Zweiten Weltkrieg.
18. und 25.2.2025
lic. phil. MICHAEL ZURWERRA
FRANZ KAFKA UND DIE PHILOSOPHIE DES EXISTENZIALISMUS

Franz Kafka, geboren 1883 in Prag, war ein deutschsprachiger jüdischer Schriftsteller, dessen Werke tief von existenziellen Themen geprägt sind. Sein Leben fiel in eine Zeit des politischen und gesellschaftlichen Umbruchs, von der Industrialisierung über den Ersten Weltkrieg bis zur Instabilität der Weimarer Republik. Kafkas literarische Werke, darunter „Die Verwandlung“, „Der Prozess“ und „Das Schloss“, spiegeln die Entfremdung, Absurdität und Sinnsuche wider, die zentrale Aspekte der existenzialistischen Philosophie sind. Beeinflusst wurde Kafka von Denkern wie Friedrich Nietzsche, dessen Ideen über den „Tod Gottes“, die radikale Freiheit und die Absurdität des Lebens für den Existenzialismus wegweisend waren. Auch Philosophen wie Søren Kierkegaard, Sigmund Freud und Karl Marx spielten eine Rolle, indem sie sich mit der menschlichen Existenz, Angst und Gesellschaftsstrukturen beschäftigten. Die Philosophie des Existenzialismus, die von Denkern wie Jean-Paul Sartre, Albert Camus und Martin Heidegger weiterentwickelt wurde, betont die individuelle Freiheit, die Verantwortung für das eigene Handeln und die Absurdität der menschlichen Existenz. Kafkas Erzählungen illustrieren diese Themen eindrücklich. In „Die Verwandlung“ erlebt Gregor Samsa eine körperliche Metamorphose, die ihn zunehmend isoliert. Seine Familie, die ihn zunächst pflegt, wendet sich schließlich von ihm ab, wodurch die Fragilität menschlicher Beziehungen sichtbar wird.
18.3.2025
DR. PHIL., MAG.ART.LIB. GERD DÖNNI
DER UNTERGANG ROMS - DROHT UNS BALD DASSELBE?

Der Untergang des Römischen Reiches war kein plötzlicher Zusammenbruch, sondern ein schleichender Prozess, der sich über mehrere Jahrhunderte erstreckte. Zahlreiche Faktoren trugen dazu bei, dass eine der mächtigsten Zivilisationen der Antike zerfiel. Besonders ausschlaggebend waren klimatische Veränderungen, wirtschaftliche Probleme, die Krise der Armee, eine Sinnkrise der Eliten, der Aufstieg des Christentums und schließlich die Migration. Interessanterweise lassen sich viele dieser Faktoren auch in unserer heutigen Welt wiederfinden. Gegen Ende der Antike verschlechterte sich das Klima spürbar. Die Temperaturen sanken, was zu Ernteausfällen und Hungersnöten führte. Besonders in den nördlichen Provinzen verschärften diese Bedingungen die Lage. Bevölkerungsgruppen aus kälteren Regionen drängten vermehrt in den Süden, um lebensfreundlichere Gebiete zu erreichen – ein Prozess, der in Kombination mit militärischen Schwächen zur Völkerwanderung beitrug. Auch heute stehen wir vor großen klimatischen Veränderungen. Extreme Wetterereignisse, Dürren und Überschwemmungen bedrohen die Ernährungssicherheit in vielen Teilen der Welt und zwingen Menschen zur Migration.
8.4.2025
PROF. DR. PHIL. ANGELO GAROVI
unter Mitwirkung von Patrizio Mazzola am Flügel und Désirée Pousaz Violinistin
KOMPONISTEN UND DAS WALLIS

Die Beziehung zwischen Musik und der Landschaft des Wallis zeigt sich besonders in den Werken jener Komponisten, die durch biografische Spuren, atmosphärische Eindrücke oder Aufführungskontexte mit dem Wallis verbunden sind. Diesen Komponisten war der Vortrag gewidmet. Richard Wagner reiste im Sommer 1852 von Meiringen aus übers Sidelhorn ins Goms nach Obergesteln und weiter via Pomatt (Formazza) an den Lago Maggiore. Er zeigte sich vom Wallis und seiner wilden, grossartigen Bergwelt tief beeindruckt. In seinen Erinnerungen beschreibt er die überwältigende Naturerfahrung auf dem Gipfel des Sidelhorns, wohin ihn nur ein „roher unheimlicher Führer" begleitete, mit folgenden Worten: „Ich gelangte zum Sidelhorn, wo ich allein unter heftigem Sturm auf dem Gipfel stand: das Gefühl des völligen Verlorenseins, des restlosen Eins-Seins mit der Natur, war überwältigend.“ Solche Erlebnisse spiegeln sich in späteren Werken wie dem Ring des Nibelungen wider und prägen dort die musikalische und philosophische Tiefe seiner Komposition. Obwohl seine Oper Tristan und Isolde nicht im Wallis entstand, passt das Finale, Isoldes Liebestod, in der Klavierfassung von Franz Liszt zur erhabenen Stille und Einsamkeit der Hochgebirgslandschaft.
13.5.2025
Dr. sc. techn. Rolf Hügli
DER PREIS DER DIGITALISIERUNG

Das Referat warf einen kritischen Blick auf die Auswirkungen der Digitalisierung in Bezug auf die Umwelt, den Energieverbrauch und die gesellschaftlichen Strukturen. Digitale Technologien erleichtern unseren Alltag und gleichzeitig zeigen sich oft verborgene Kosten für Umwelt und Ressourcen. Ein zentrales Thema ist der enorme Energieverbrauch digitaler Infrastrukturen. Vor allem Videostreaming, das inzwischen 80 Prozent des weltweiten Datenverkehrs ausmacht, verschlingt gewaltige Mengen an Strom. Rechenzentren und Datennetze verbrauchen weltweit jährlich rund 700 Terawattstunden Strom, was etwa drei Prozent des globalen Stromkonsums entspricht. Zum Vergleich entspricht dies der Produktion von etwa 90 Atomkraftwerken. Auch in Europa hat die Digitalisierung einen grösseren CO₂-Fussabdruck als der gesamte Flugverkehr. Besonders problematisch ist die Herstellung digitaler Geräte, die rund 41 Prozent der CO₂-Emissionen ausmacht, gefolgt vom Betrieb der Infrastruktur (37 Prozent) und der Nutzung im Haushalt (22 Prozent). Allein in Deutschland verursacht jeder Mensch jährlich etwa 850 Kilogramm CO₂ durch die Nutzung digitaler Technologien – fast die Hälfte des als nachhaltig geltenden Jahresbudgets.
21. bis 28. Juni 2025
AUVERGNEREISE
 Die Reisegruppe des Vortragsvereins Oberwallis begab sich auf eine eindrucksvolle kunsthistorische Reise durch die Auvergne, einer Region, die wie kaum eine andere die Vielfalt europäischer Kunstgeschichte in einer naturnahen Landschaft zur Darstellung bringt. Von den Renaissancefassaden Lyons bis zu den romanischen Abteien der Vulkangebiete offenbarte sich eine kulturelle Dichte, die in dieser Form selten ist. In Lyon eröffnete sich mit dem Viertel Vieux Lyon ein erstes bedeutendes Kapitel: Die von der UNESCO geschützte Altstadt gehört zu den grössten erhaltenen Renaissance-Vierteln Europas. Die schmalen, gepflasterten Gassen, die eleganten Bürgerhäuser und insbesondere die Traboules, versteckte Passagen durch Innenhöfe, vermittelten ein lebendiges Bild städtischer Architektur und Lebensweise des 16. Jahrhunderts. Den Auftakt des Aufenthalts in Clermont-Ferrand bildete der Besuch der „L’Aventure Michelin“, eines modernen Museums, das die faszinierende Geschichte des weltbekannten Reifenherstellers Michelin erzählt. Die Stadt Clermont-Ferrand präsentiert sich als Zentrum gotischer und romanischer Sakralarchitektur. Die Kathedrale Notre-Dame-de-l’Assomption, aus dem dunklen Vulkangestein Volvic errichtet, erhebt sich majestätisch über der Stadt. Ihre schlanken Türme, die klar gegliederte Fassade und die farbkräftigen Fensterrosen zeugen vom gotischen Formenreichtum in einer ganz eigenen regionalen Ausprägung. Nur wenige Schritte entfernt erinnert die romanische Basilika Notre-Dame-du-Port an die tiefe Spiritualität des Hochmittelalters. Ihre harmonische Bauform, die Krypta mit der Schwarzen Madonna und die kunstvolle Steinmetzarbeit zeigen die auvergnatische Romanik eindrücklich: klare Linien, plastische Ornamentik und innere Geschlossenheit.
Die Reisegruppe des Vortragsvereins Oberwallis begab sich auf eine eindrucksvolle kunsthistorische Reise durch die Auvergne, einer Region, die wie kaum eine andere die Vielfalt europäischer Kunstgeschichte in einer naturnahen Landschaft zur Darstellung bringt. Von den Renaissancefassaden Lyons bis zu den romanischen Abteien der Vulkangebiete offenbarte sich eine kulturelle Dichte, die in dieser Form selten ist. In Lyon eröffnete sich mit dem Viertel Vieux Lyon ein erstes bedeutendes Kapitel: Die von der UNESCO geschützte Altstadt gehört zu den grössten erhaltenen Renaissance-Vierteln Europas. Die schmalen, gepflasterten Gassen, die eleganten Bürgerhäuser und insbesondere die Traboules, versteckte Passagen durch Innenhöfe, vermittelten ein lebendiges Bild städtischer Architektur und Lebensweise des 16. Jahrhunderts. Den Auftakt des Aufenthalts in Clermont-Ferrand bildete der Besuch der „L’Aventure Michelin“, eines modernen Museums, das die faszinierende Geschichte des weltbekannten Reifenherstellers Michelin erzählt. Die Stadt Clermont-Ferrand präsentiert sich als Zentrum gotischer und romanischer Sakralarchitektur. Die Kathedrale Notre-Dame-de-l’Assomption, aus dem dunklen Vulkangestein Volvic errichtet, erhebt sich majestätisch über der Stadt. Ihre schlanken Türme, die klar gegliederte Fassade und die farbkräftigen Fensterrosen zeugen vom gotischen Formenreichtum in einer ganz eigenen regionalen Ausprägung. Nur wenige Schritte entfernt erinnert die romanische Basilika Notre-Dame-du-Port an die tiefe Spiritualität des Hochmittelalters. Ihre harmonische Bauform, die Krypta mit der Schwarzen Madonna und die kunstvolle Steinmetzarbeit zeigen die auvergnatische Romanik eindrücklich: klare Linien, plastische Ornamentik und innere Geschlossenheit.
6.9.2025
TAGESAUSFLUG INS FORMAZZATAL
 Am Samstag, 6. September 2025, führte der Ausflug 40 Vereinsmitglieder ins Formazzatal, zunächst nach Ponte, wo Mattheo Egel einen spannenden und instruktiven Vortrag hielt. Er sprach nicht nur über die Walserkultur des Tales selbst, sondern stellte die Auswanderungen der Walser in den Mittelpunkt. Dabei beleuchtete er die Routen, über die sie in verschiedene Alpenregionen gelangten, und erklärte, wie die Walser ihre Sprache und Kultur auf diesen Wegen mitgenommen und weiterentwickelt haben. Anschliessend begab sich die Gruppe zum Mittagessen ins Hotel/Restaurant Edelweiss. Das gemütliche Beisammensein bot Gelegenheit, das Gehörte zu vertiefen und sich auszutauschen. Am Nachmittag stand ein Besuch in Riale, dem höchstgelegenen Dorf des Tals, auf dem Programm. Die eindrucksvolle Landschaft und die charakteristische Architektur gaben einen lebendigen Eindruck von der Walserbauweise in extremer Höhenlage.
Am Samstag, 6. September 2025, führte der Ausflug 40 Vereinsmitglieder ins Formazzatal, zunächst nach Ponte, wo Mattheo Egel einen spannenden und instruktiven Vortrag hielt. Er sprach nicht nur über die Walserkultur des Tales selbst, sondern stellte die Auswanderungen der Walser in den Mittelpunkt. Dabei beleuchtete er die Routen, über die sie in verschiedene Alpenregionen gelangten, und erklärte, wie die Walser ihre Sprache und Kultur auf diesen Wegen mitgenommen und weiterentwickelt haben. Anschliessend begab sich die Gruppe zum Mittagessen ins Hotel/Restaurant Edelweiss. Das gemütliche Beisammensein bot Gelegenheit, das Gehörte zu vertiefen und sich auszutauschen. Am Nachmittag stand ein Besuch in Riale, dem höchstgelegenen Dorf des Tals, auf dem Programm. Die eindrucksvolle Landschaft und die charakteristische Architektur gaben einen lebendigen Eindruck von der Walserbauweise in extremer Höhenlage.
16.9.2025
Prof. Dr. Johannes Gräff
Epigenetik – Jenseits der Mendelschen Genetik?
Die klassische Genetik, wie sie seit Gregor Mendel im 19. Jahrhundert entwickelt wurde, beschäftigt sich mit der Vererbung genetischer Information. Sie betrachtet die DNA als Trägerin der Erbinformation, die in Form von Genen in den Chromosomen gespeichert ist. Doch seit einigen Jahrzehnten wissen wir, dass es nicht nur darauf ankommt, welche Gene vorhanden sind, sondern auch darauf, wie und wann sie abgelesen werden. Damit befasst sich die Epigenetik: Sie untersucht die Mechanismen, die die Aktivität von Genen steuern, ohne die zugrunde liegende DNA-Sequenz zu verändern. Die DNA liegt im Zellkern nicht frei vor, sondern ist um Histone gewickelt. Diese DNA-Protein-Komplexe heissen Nukleosomen und bilden in verdichteter Form die Chromosomen. Epigenetische Prozesse wirken an dieser Verpackung: Einerseits durch DNA-Methylierung, bei der bestimmte Basen chemisch markiert werden, andererseits durch Modifikationen der Histone, die die Zugänglichkeit der DNA beeinflussen. Gene in einer offenen, weniger verdichteten Struktur können abgelesen und transkribiert werden, während andere durch Methylierung oder enge Verpackung stummgeschaltet bleiben. Ein anschauliches Beispiel: Jede Zelle im Körper besitzt denselben genetischen Bauplan. Dennoch unterscheiden sich Nervenzellen und Hautzellen fundamental. Die Erklärung liegt in epigenetischen Mechanismen, die bestimmen, welche Gene aktiv sind. Diese Prozesse sind nicht starr, sondern dynamisch und können auch durch Umweltfaktoren beeinflusst werden.