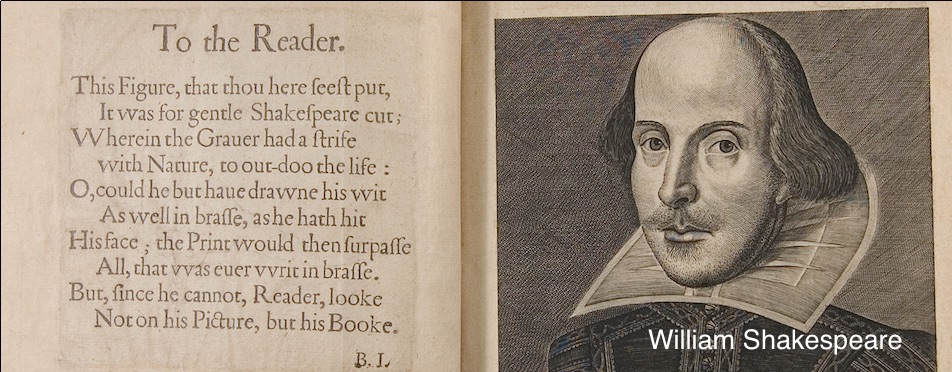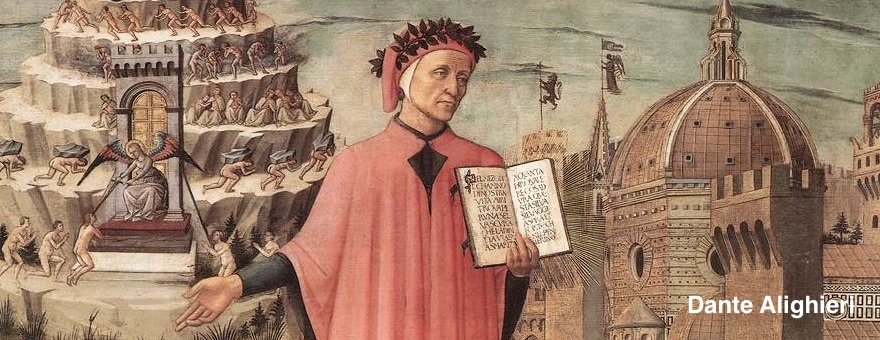24.1. und 31.1.2017
Dr. Jakob Knaus, ehemaliger Musikredaktor DRS 2
Zur Kulturgeschichte des Walzers
 Ansätze für den späteren „Wiener Walzer“ gab es bereits bei Mozart. Bei Carl Maria von Weber kam 1819 das drehende Moment und der typische ¾-Takt-Rhythmus in seiner „Aufforderung zum Tanz opus 65“ erstmals klar zur Geltung. Die weitere Entwicklung vom höfischen Menuett und Scherzo zum drehenden und vorerst ungeziemlichen, körpernahen und schwungvollen Drehen im Walzertakt geschah dann vor allem bei den Komponisten Joseph Lanner (1801-1843) und in Vollendung bei der Strauss-Familie (Johann Strauss Vater und seinen Söhnen). Der Referent demonstrierte und machte deutlich, dass bei der Komposition eines einzelnen Walzers mehrere, gekonnt strukturierte Walzerthemen zur Anwendung kommen.
Ansätze für den späteren „Wiener Walzer“ gab es bereits bei Mozart. Bei Carl Maria von Weber kam 1819 das drehende Moment und der typische ¾-Takt-Rhythmus in seiner „Aufforderung zum Tanz opus 65“ erstmals klar zur Geltung. Die weitere Entwicklung vom höfischen Menuett und Scherzo zum drehenden und vorerst ungeziemlichen, körpernahen und schwungvollen Drehen im Walzertakt geschah dann vor allem bei den Komponisten Joseph Lanner (1801-1843) und in Vollendung bei der Strauss-Familie (Johann Strauss Vater und seinen Söhnen). Der Referent demonstrierte und machte deutlich, dass bei der Komposition eines einzelnen Walzers mehrere, gekonnt strukturierte Walzerthemen zur Anwendung kommen.
07. und 14.03.2017
Michael Zurwerra, lic. phil.
Vom Mythos zum rationalen Denken - Die griechische Philosophie bis Sokrates

Das philosophische Denken des Abendlandes begann bei den Vorsokratikern im antiken Griechenland, wobei diesem Kulturkreis nicht nur das heutige Griechenland mit den griechischen Inseln, sondern auch die griechischen Kolonien Kleinasiens und Unteritaliens angehörten. Allgemein wird Thales von Milet (624-547 v. Chr.) als der erste dieser Vorsokratiker genannt, der als „Arche“, als Urform allen Seins, das Wasser, benannte. Bei Anaximander war es „Apeiron“, das „Unbegrenzte“ und bei Anaximenes war es das Feuer. Bei Heraklit von Ephesus (520- 460 v. Chr.) war die eigentliche Gesetzmässigkeit das Werden und Vergehen, das er „logos“ nannte. Für Parmenides aus Elea, der etwa zur gleichen Zeit wie Heraklit gelebt hat, ist die Wirklichkeit und das Seiende abstrakt in unseren Vorstellungen vorhanden und unveränderbar. Diese beiden unterschiedlichen Auffassungen der “Wahrheit“ allen Seins bei den beiden Philosophen Heraklit und Parmenides widerspiegeln sich in der ganzen weiteren Philosophiegeschichte. Der Referent wies darauf hin, dass z.B. im Konzil von Ephesus im Jahre 431 n. Chr. diese beiden unterschiedlichen Auffassungen aufeinanderprallten. Als eigentliche Repräsentanten dieser philosophischen Richtungen können später in der klassischen griechischen Philosophie Platon und Aristoteles genannt werden. Im Gegensatz zu Platon mit seiner Ideenlehre erschloss sich für Aristoteles die Welt über Erkenntnis und die Naturwissenschaften. Bei den Vorsokratikern darf Demokrit von Abdera (460-371 v. Chr.) und seine Atomlehre nicht unerwähnt bleiben.
04.04.2017
Alois Grichting, Dr. rer. pol., Dipl. Ing. ETHZ
Das Walliser Jahrbuch - Eine Kulturschrift: 1932-2017

Initiator des Walliser Jahrbuches war Domherr Joseph Werlen (1872-1940). Viele Gründungsmitglieder mit bekannten Namen unterstützten die Anregung für einen "Volkskalender", der neben unterhaltenden und bildenden Beiträgen auch einen erzieherischen Zweck haben sollte. Der erste Vorstand des 1931 gegründeten und das Jahrbuch unterstützenden Vereins waren neben Domherr Joseph Werlen, der die Präsidentschaft übernahm, Dr. Raimund Loretan, Staatsratspräsident in Sitten und Dr. Raphael Mengis, Professor in Sitten, der als erster Aktuar zeichnete. Im Redaktionsausschuss wirkten viele Professoren des Kollegiums Spiritus Sanctus mit, wie z.B. Prof. Albert Schnyder, Prof. Franz Jost und Prof. Dr. Albert Julen. Im Konzept des Jahrbuches wurde der zukünftige Inhalt breit und vielfältig umschrieben. Neben einem Kalendarium sollten Kunst, Geschichte, Heilkunde, Naturkunde, die Schule, aber auch Religiöses, eine Walliser Chronik und vieles mehr Platz finden. Das erste Titelblatt wurde durch Julius Salzgeber, Zeichnungslehrer am Kollegium Spiritus Sanctus, gestaltet. Ab 1936 zierte Kardinal Schiner das Titelblatt, was bis heute beibehalten wurde. Viele im Kulturleben des Wallis bekannte Namen wirkten über all die Jahre mit an der Gestaltung und der Verbreitung des Jahrbuches. Unzählig sind auch die Beiträge, die in einem Registerband im Jahre 2000 durch den Redaktor, Dr. Alois Grichting, zusammengefasst wurden und für Interessierte und Forscher eine ergiebige Quelle der Walliser Kultur darstellen.
09.05.2017
Johannes Luther, M.A.
Wallis, Burgund, Europa - Die Bedeutung des Bischofs Ermenfried von Sitten für die Walliser Geschichtsschreibung
 Johannes Luther zeigte anschaulich, dass im 11. Jahrhundert Ermenfried ein äusserst einflussreicher Bischof des Bistums Sitten war. Neben seinen wichtigen Beziehungen mit Burgund machte er seinen Einfluss auch in vielen europäischen Ländern geltend und er genoss ein hohes Ansehen im damaligen christlichen Europa. Erstmals wird der Name Ermenfried im Jahre 1041 urkundlich erwähnt. Als päpstlicher Legat unternahm er Reisen in Vertretung des Heiligen Stuhles bis nach England und zum damaligen Regenten, Wilhelm dem Eroberer. Das 11. Jahrhundert war zudem durch den Investiturstreit geprägt und erreichte seinen Höhepunkt in der Auseinandersetzung zwischen König Heinrich IV und dem römischen Papst Gregor VII. Es erscheint möglich, dass beim Gang nach Canossa im Jahre 1076/77 König Heinrich IV auch die Hilfe des Bischofs Ermenfried beansprucht hat, da Ermenfried sich auf die Seite des Königs stellte. Eine wichtige Cäsur in der damaligen Christenheit war auch die im Jahre 1054 erfolgte Trennung zwischen der West- und der Ostkirche (Leo IX und Michael I).
Johannes Luther zeigte anschaulich, dass im 11. Jahrhundert Ermenfried ein äusserst einflussreicher Bischof des Bistums Sitten war. Neben seinen wichtigen Beziehungen mit Burgund machte er seinen Einfluss auch in vielen europäischen Ländern geltend und er genoss ein hohes Ansehen im damaligen christlichen Europa. Erstmals wird der Name Ermenfried im Jahre 1041 urkundlich erwähnt. Als päpstlicher Legat unternahm er Reisen in Vertretung des Heiligen Stuhles bis nach England und zum damaligen Regenten, Wilhelm dem Eroberer. Das 11. Jahrhundert war zudem durch den Investiturstreit geprägt und erreichte seinen Höhepunkt in der Auseinandersetzung zwischen König Heinrich IV und dem römischen Papst Gregor VII. Es erscheint möglich, dass beim Gang nach Canossa im Jahre 1076/77 König Heinrich IV auch die Hilfe des Bischofs Ermenfried beansprucht hat, da Ermenfried sich auf die Seite des Königs stellte. Eine wichtige Cäsur in der damaligen Christenheit war auch die im Jahre 1054 erfolgte Trennung zwischen der West- und der Ostkirche (Leo IX und Michael I).
08.07.2017
Cornwallreise
 32 Mitglieder des Vortragsvereins begaben sich vom 1. bis am 8. Juli 2017 auf eine Kulturreise nach Cornwall und erlebten bei herrlichem Wetter eine geschichtsträchtige, traumhafte und bezaubernde Landschaft mit malerischen Gärten und reich ausgestatteten Herrschaftshäusern. Lanhydrock und seine gepflegten Parks entzückten die Besucher durch ein ausgesuchtes Interieur und eine verführerische Blumenpracht. Mevagissey diente früher nicht nur den einheimischen Fischern, sondern auch den Schmugglern als geschützter Hafen und besticht durch sein malerisches Leben. Auch die „Lost Gardens of Heligan“ vermochte die Reisegruppe durch seine geheimnisvolle Gartenarchitektur in ihren Bann zu ziehen. Der Dartmoor Nationalpark verströmt mit seinem weiten Himmel und seinen mystischen Landschaften ein geheimnisvolles Licht, das bereits den Schriftsteller Arthur Conan Doyle gefangen nahm. Einer der prachtvollsten Landsitze im Südwesten Englands ist „Saltram House and Gardens“, das mit seiner originalen Möblierung im frühen georgianischen Stil und seinen vielen Bildern von Joshua Reynolds zu entzücken vermochte.
32 Mitglieder des Vortragsvereins begaben sich vom 1. bis am 8. Juli 2017 auf eine Kulturreise nach Cornwall und erlebten bei herrlichem Wetter eine geschichtsträchtige, traumhafte und bezaubernde Landschaft mit malerischen Gärten und reich ausgestatteten Herrschaftshäusern. Lanhydrock und seine gepflegten Parks entzückten die Besucher durch ein ausgesuchtes Interieur und eine verführerische Blumenpracht. Mevagissey diente früher nicht nur den einheimischen Fischern, sondern auch den Schmugglern als geschützter Hafen und besticht durch sein malerisches Leben. Auch die „Lost Gardens of Heligan“ vermochte die Reisegruppe durch seine geheimnisvolle Gartenarchitektur in ihren Bann zu ziehen. Der Dartmoor Nationalpark verströmt mit seinem weiten Himmel und seinen mystischen Landschaften ein geheimnisvolles Licht, das bereits den Schriftsteller Arthur Conan Doyle gefangen nahm. Einer der prachtvollsten Landsitze im Südwesten Englands ist „Saltram House and Gardens“, das mit seiner originalen Möblierung im frühen georgianischen Stil und seinen vielen Bildern von Joshua Reynolds zu entzücken vermochte.
19.09.2017
Nicolas Eyer, M.A.
Die "Bilder der fliessenden Welt"
JAPANISCHE ukiyo-e-KUNST UND IHRE NACHWIRKUNG
 Wenn man bei uns von japanischer Kunst spricht, so tut man dies meist mit einem bestimmten Bild im Kopf: Dem Farbholzschnitt «Die grosse Welle vor Kanagawa» von Katsushika Hokusai. Dieser Druck sowie die Ansichten der damaligen Hauptstadt Edo von Utagawa Hiroshige haben auch bei uns weite Verbreitung gefunden.
Wenn man bei uns von japanischer Kunst spricht, so tut man dies meist mit einem bestimmten Bild im Kopf: Dem Farbholzschnitt «Die grosse Welle vor Kanagawa» von Katsushika Hokusai. Dieser Druck sowie die Ansichten der damaligen Hauptstadt Edo von Utagawa Hiroshige haben auch bei uns weite Verbreitung gefunden.
In seinem Vortrag legte Referent Nicolas Eyer dar, dass diese Drucke zu einer eigenen Kunstrichtung gehören, den sogenannten Ukiyo-e, was soviel heisst wie «Bilder der fliessenden Welt». Sie entwickelten sich in der Edo-Zeit zwischen 1603 und 1868, als Japan von der Aussenwelt abgeschottet war. Alle Macht im Land lag damals in den Händen der Shogune, der Militärregenten, die ihr Hauptquartier in Edo, dem heutigen Tokyo, eingerichtet hatten. Unter ihnen entwickelte sich das kleine Fischerdorf zu einer Metropole, in welcher die Künste und die flüchtige Unterhaltung blühten. Berühmte Schauspieler, schöne Kurtisanen und siegreiche Sumoringer waren die Idole dieser Zeit, und eine ganze Kunstindustrie war damit beschäftigt, sie ins Bild zu bannen. Das waren die Ukiyo-e, Bilder, welche das Vergängliche, Flüchtige festhalten wollten. Neben diesen Drucken entstanden auch Landschafts- und Naturdarstellungen, die bis heute unsere Vorstellung vom alten Japan prägen.
03.10.2017
Dr. phil. Hans Steffen
Hexenjagden im Oberwallis
Im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit wurden viele Frauen und auch Männer als Hexen angeklagt, verurteilt und hingerichtet. Vor dem Jahre 1400 sprach man von Zauberern oder Magiern und erst nach dem Jahre 1400 kam die Hexenverfolgung auf. Man bezichtigte die als Hexen Angeklagten als Teufelsanbeter, als Satansdiener und als Häretiker. Dr. Hans Steffen führte als eindrückliches Beispiel die verurteilte Hexe Nesa Blantscho an, eine in Niedergesteln wohnhafte Witwe, die aus Ausserberg stammte und als Hexe am 18. Mai 1611 verurteilt und wahrscheinlich auf dem Dorfplatz von Niedergesteln hingerichtet wurde. Alle als Hexen angeklagten Personen konnten nur verurteilt werden, wenn sie ein Geständnis ablegten, das meist durch Folter erpresst wurde. Die Anklage lautete auf Teufelsanbetung, auf Paktieren mit dem Satan und auf Schadenzauber. Meist wurden unliebsame Personen durch die Öffentlichkeit denunziert, von den Behörden einvernommen, gefoltert, abgeurteilt und im Wallis mit dem Einverständnis des Bischofs von Sitten hingerichtet.
07.10.2017
Kunstreise Freiburg i. Ue.

Eine stattliche Anzahl Mitglieder des Vortragsvereins Oberwallis begab sich auf Kunstreise nach Freiburg i. Ue. Die Stadt präsentierte sich in schönstem Herbstsonnenwetter. Freiburg wurde im Jahre 1157 durch Berthold IV von Zähringen gegründet.
Die Stadt beeindruckt durch ihre gut erhaltene Bausubstanz, schöne mittelalterlich anmutende Plätze und Brücken, imposante Stadttore und zahlreiche historische Bauten, allen voran eine der schönsten gotischen Kathedralen der Schweiz, die dem heiligen Nikolaus von Myra geweiht ist. Die professionelle Führung machte auf die geschichtliche Bedeutung der Kathedrale aufmerksam und wies auf die zahlreichen grossartigen sakralen Kunstwerke hin. Besondere Beachtung verdienen die prächtigen Glasfenster und die beiden Kathedralorgeln. Bemerkenswert sind auch die dreizehn Statuen aus dem 15. Jh. in der Grabeskapelle, welche die Grablegung Christi versinnbildlichen. Besuchenswert ist auch die prächtige neapolitanische Krippe in der Liebfrauenkirche, die mit ihren zahlreichen Figuren und Szenen südlichen Lebens die Geburt Christi in einer neapolitanischen Landschaft darstellt.
21.11.2017
Dr. med. Karl Peter Jungius
Medizinische Bildgebung: gestern - heute - morgen

Die Geschichte der Radiologie beginnt mit Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), einem deutschen Physiker, der für die Entdeckung der Röntgenstrahlen und deren Anwendung in der medizinischen Diagnostik im Jahre 1901 den ersten Nobelpreis für Physik erhielt. Marie Curie (1867-1934) und Henri Becquerel (1852-1908) wurde im Jahre 1903 für die Erforschung der Radioaktivität ebenfalls der Nobelpreis für Physik verliehen. Ein weiterer Meilenstein in der radiologischen Diagnostik war die Entwicklung der Computertomographie, wobei zwei weitere Forscher, Allan M. Cormack (1924-1998) und Godfrey N. Hounsfield (1919-2004), im Jahre 1979 mit dem Nobelpreis für Medizin belohnt wurden. Die Computertomographie ist inzwischen aus der heutigen Medizindiagnostik nicht mehr wegzudenken. Der Referent ging des weitern auf die Entwicklung des Ultraschalls und vor allem auf die Magnetresonanztomographie ein. Auch auf diesem Gebiet wurden im Jahre 1952 Nobelpreise für Physik an Felix Bloch (1905-1983) und an Edward M. Purcell (1912-1997) verliehen. Neben Felix Bloch wurden zwei weitere Schweizer, Richard R. Ernst 1991 und Kurt Wüthrich 2002 mit Nobelpreisen für Chemie für ihre Beiträge zur Magnetresonanzspektroskopie beehrt. Unterschiedliche Kernspin-Relaxationszeiten in verschiedenen biologischen Geweben bilden in der Magnetresonanztomographie die Basis für bildgebende diagnostische Verfahren. Im Jahre 2003 erhielten weitere Forscher, Sir Peter Mansfield (1933-2017) und Paul C. Lauterbur (1929-2007), Nobelpreise für Medizin für ihre Arbeiten im Gebiete der Magnetresonanztomographie.