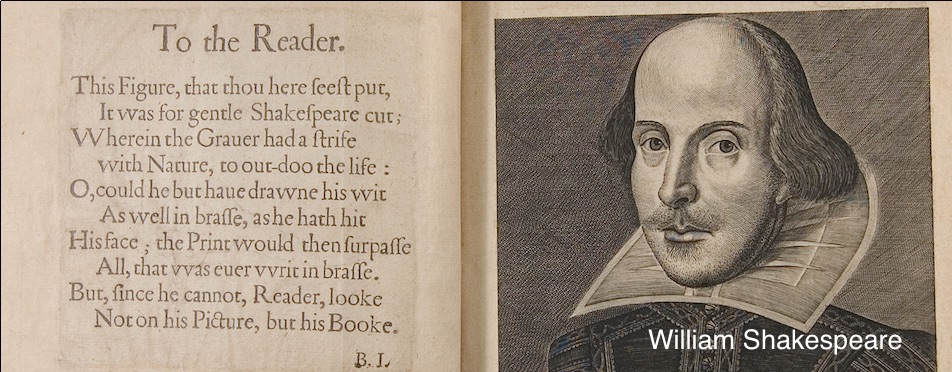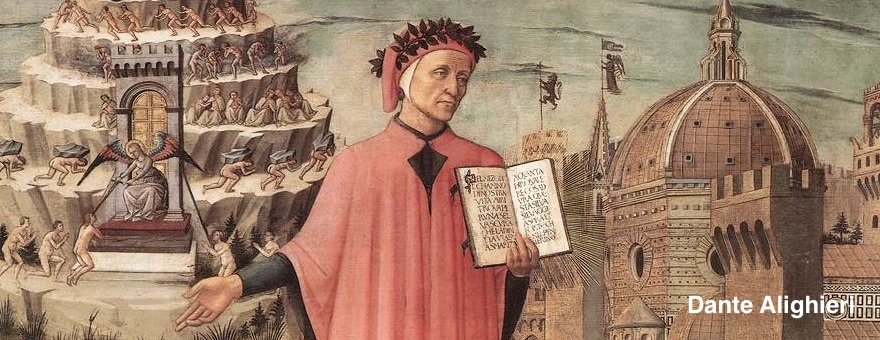18.9.2021
BESICHTIGUNG DER NEU RENOVIERTEN WALLFAHRTSKIRCHE GLIS

35 Mitglieder des Vortragvereins liessen sich unter kundiger Führung durch Frau Gabriele Armangau anlässlich der Besichtigung der neu gestalteten Wallfahrtskirche von Glis begeistern. Bereits anfangs des 7. Jahrhunderts stand in Glis am Standort der jetzigen Kirche ein erstes Gotteshaus, bzw. ein Baptisterium. Von 1648 bis 1668 liess der Grosse Stockalper (1609-1691) durch die Brüder Bodmer die heutige mächtige, barocke Pfeilerbasilika errichten. Eine offene Arkadenvorhalle wurde zwischen 1660 und 1670 diesem Frühbarockschiff angefügt. Vorgängig zeugten bereits romanische und gotische Elemente von der langen Entstehungsgeschichte der Kirche. Den gotischen prächtigen Hochaltar aus dem Jahre 1480 gestaltete der Basler Bildhauer Heinrich Isenhut mit Statuen von Maria, der hl, Katharina, dem Apostel Johannes, der hl. Barbara und dem hl. Georg. Die Altarflügel zeigen die Geburt Christi und die Anbetung der Könige. Mit der baulichen Neugestaltung der Gliser Kirche unter Kaspar Stockalper erhielt die Kirche einen barocken Altar, der in Domodossola gefertigt wurde. Der gotische Flügelaltar verschwand damals aus der Kirche und wurde stückweise im Kirchturm eingelagert.. Im Jahre 1904 fand der gotische wiederhergestellte Flügelaltar erneut seinen Platz in der Kirche. Neben Münster im Goms und dem gotischen Hochaltar in der Churer Kathedrale besitzt Glis einen der schönsten gotischen Altäre der Schweiz. Der ehemalige barocke Hochaltar steht nun seit 1906 im elsässischen Bollweiler. Der linke Seitenaltar stellt die hl. Anna selbdritt dar und ist eine Stiftung von Georg Supersaxo (1450-1529), der auf der Rückseite des Altars auch mit seiner Gattin und seinen 23 Kindern dargestellt ist.
25.10.2021
Pfarrer Tillmann Luther
RHETORIKVORTRAG: "SO WERDEN SIE EIN GUTER REDNER"

Nach einer längeren Covid-bedingten Pause nahm der Vortragsverein Oberwallis mit einem Referat zum Thema Rhetorik seine Vortrags-Aktivität wieder auf. Der Referent, Tillmann Luther, beliebter und angesehener Pfarrer in Visp, wurde im Jahre 2013 in Budapest Europameister im Stegreifreden. Er lehrt an diversen Institutionen die Redekunst und ist somit für dieses Thema bestens gerüstet. In seinem Vortrag hielt er sich an das Motto des Rhetorikclubs Bern, dessen Mitbegründer er ist, «Gute Redner werden nicht geboren, sie werden gemacht». Wie kann man vor einem Publikum überzeugend auftreten? Mit welchen Tricks und rhetorischen Mitteln wird die Zuhörerschaft gefesselt, welche Fehler sollten bei einer guten Rede vermieden werden? Wie sieht ein Redeanfang und ein fulminantes Ende aus? Ein guter Redner muss sein Publikum mit authentischen, perfekten und spannenden Stilmitteln zu überzeugen versuchen.
22. und 29. Novermber 2021
lic. phil. Diether Demont
DEUTSCHE LITERATURGESCHICHTE: ALTHOCHDEUTSCH BIS BAROCK

Vom «Abrogans» zum «Simplicissimus»
Der Referent, früherer Lehrer am Briger Kollegium für die Fächer Deutsch, Latein und Geschichte, spannte in seinen beiden inhaltlich dichten Vorträgen einen Bogen von den frühesten schriftlichen Zeugnissen deutscher Sprache bis hin zu Grimmelshausens Schelmenroman «Der abenteuerliche Simplicissimus» von 1669. Beim ersten Buch in deutscher Sprache, dem «Abrogans», welcher in der Stiftsbibliothek von St. Gallen aufbewahrt wird, handelte es sich noch um ein Wörterbuch. Lange Zeit führte das Althochdeutsche gegenüber der Bildungssprache Latein nämlich ein Nischendasein. Die wenigen althochdeutschen Aufzeichnungen jener Zeit waren mehrheitlich Übertragungen geistlicher Texte aus dem Lateinischen. Texte wie die «Merseburger Zaubersprüche» aus dem 8. oder der «Wurmsegen» aus dem 9. Jahrhundert zeigen zudem deutlich den allmählichen Übergang von einer heidnisch-germanischen zu einer christlichen Weltsicht.
Orte der literarischen Produktion im Frühmittelalter waren primär die Schreibstuben der Klöster. Wie Diether Demont treffend anmerkte, herrschte eine Art Mangelwirtschaft. Pergament war wertvoll, so dass es liturgischen Texten vorbehalten blieb. Deutschsprachige Literatur kam höchstens als Füllsel in lateinischen Werken vor oder ist auf Palimpsesten (abgeschabte und erneut beschriebene Blätter) erhalten geblieben. Erst im Verlauf des Hochmittelalters verlegte sich die literarische Produktion an die Fürstenhöfe, womit eine Stärkung des Deutschen einherging. Themen dieser höfischen Literatur, die meist von Laiendichtern geschrieben wurde, waren nun ritterliche Tugenden wie Tapferkeit, Gerechtigkeit und Weisheit.